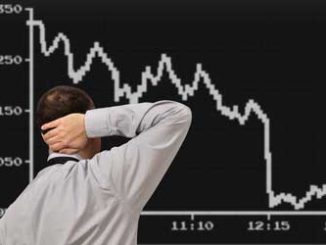Fahnder oder Finanzpolizist? So lautet die entscheidende Frage bei einer Hausdurchsuchung. Denn die Aufgabe des Steuerfahnders regelt auch die Rechte des Steurpflichtigen bei der Durchsuchung. Ein Rechtsanwalt der Kanzlei DHPG erklärt, was Steuerpflichtige bei einer Durchsuchung ihrer Privat- und Geschäftsräume beachten sollten.
Steuerfahnder kommen Steuersündern aus ganz unterschiedlichen Anlässen auf die Spur. Neben verwaltungsinternen Kontrollmitteilungen oder Betriebsprüfungen sorgen in vielen Fällen anonyme Anzeigen für die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens. Hinter diesen Anzeigen steckt oft ein Racheakt. Dabei profitiert das Finanzamt zum Beispiel vom Insiderwissen des geschiedenen Ehepartners oder des ausgebooteten Geschäftspartners. In anderen Fällen weiß ein geschasster Mitarbeiter zu viel. Oder hinter der anonymen Anzeige steckt ein Wettbewerber, der seinem Konkurrenten mit einer Anzeige beim Finanzamt das Leben schwer machen möchte. Sofern anonyme Anzeigen nicht offensichtlich aus der Luft gegriffen sind, müssen Steuerfahnder den Hinweisen nachgehen.
Steuerfahnder setzen bei der Durchsuchung auf Überraschungseffekt
Rücken die Steuerfahnder zur Durchsuchung an, nutzen sie regelmäßig das Überraschungsmoment. Plötzlich stehen sie vor der Haustür oder vor dem Büro und treffen dort in aller Regel auf verunsicherte Steuerzahler. Das liegt nach Ansicht der Wirtschaftskanzlei DHPG daran, dass viele Steuerpflichtige weder ihre Rechte noch ihre Pflichten gegenüber Steuerfahndern kennen und sich deshalb bei einer Durchsuchung prompt unbedacht verhalten. Ein Fehler sei es, den ermittelnden Beamten ohne Not weitere Angriffspunkte zu bieten.
Rechtsanwalt Markus Feinendegen von DHPG in Bonn klärt auf: „Die Befugnisse der Steuerfahnder sind unterschiedlich und hängen davon ab, welche Aufgabe sie im konkreten Fall wahrnehmen.“ Steuerfahnder agieren entweder als Betriebsprüfer oder als „Finanzpolizist“.
Als Betriebsprüfer decken die Steuerfahnder bislang unbekannte Steuerfälle auf und handeln wie jeder andere Prüfer mit steuerlichen Befugnissen. Betroffene sind zur Mitwirkung verpflichtet, anderenfalls drohen Zwangsgelder.
In der Funktion „Finanzpolizist“ ermitteln Steuerfahnder dagegen in entdeckten Steuerstraftaten und suchen nach Beweismitteln. Sie haben dann die gleichen Befugnisse wie Polizisten. Betroffene müssen dann zwar die Durchsuchung und Sicherstellung von Unterlagen dulden, dürfen aber ihre Aussage verweigern. Ihre Mitwirkung im Besteuerungsverfahren kann nicht mehr mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden.
Dieser Unterschied erklärt, warum es wichtig ist, dass der Steuerpflichtige bei der Durchsuchung genau versteht, welche Aufgabe die Steuerfahnder gerade wahrnehmen.
Unsicherheit und Redseligkeit werden zum gefundenen Fressen für Steuerfahnder
Verunsicherte Steuerzahler spielen Fahndern in die Hände. „Oft stehen Steuerzahler bei einer Durchsuchung unter Schock und sind zu redselig“, sagt Rechtsanwalt Feinendegen. Die eigene Unsicherheit wird so zum gefundenen Fressen für die Steuerfahnder. „Fahnder greifen spontane Äußerungen dankbar auf und erstellen Protokolle, die später kaum zu korrigieren sind.“
Die Kanzlei DHPG rät: Steuerzahler sollten sich grundsätzlich auf die Möglichkeit einer Durchsuchung vorbereiten. Zum Beispiel sollte der Steuerpflichtige die Aufbewahrung von Unterlagen kritisch hinterfragen. „Steuerfahnder suchen häufig nach persönlichen Aufzeichnungen und in Privaträumen aufbewahrten Dokumenten, um den Tatverdacht zu erhärten“, erklärt Feinendegen. Der Rechtsanwalt empfiehlt, „einen Handlungsplan zu entwickeln. So können Steuerzahler souverän agieren und laufen nicht Gefahr, ihre Position unbedacht zu schwächen.“
So verhalten sich Betroffene bei der Durchsuchung richtig
Das erste Gebot bei einer Durchsuchung lautet: Ruhe bewahren, wenig reden!
Steuerzahler sollten sich bei einer Durchsuchung als erstes den Durchsuchungsbeschluss sowie die Ausweise der Beamten zeigen lassen und ihre Namen notieren.
Dann sollten Steuerzahler unverzüglich ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater anrufen, damit dieser an der Durchsuchung teilnimmt. Am besten der Steuerpflichtige lässt sich den Durchsuchungsbeschluss aushändigen und faxt diesen seinem Berater zu. Außerdem sollte der Steuerzahler den Einsatzleiter dazu bringen, mit der Durchsuchung solange zu warten, bis der Rechtsanwalt oder Steuerberater eingetroffen ist.
Steuerfahnder wissen oft mehr als dem Steuerzahler lieb ist
Steuerzahler sollten die Fahnder nicht unterschätzen. Denn einer Durchsuchung gehen in aller Regel umfassende Ermittlungen voraus. Die Fahnder wissen also „viel mehr, als man sich das im Zeitpunkt des ersten Kontakts vorstellen kann“, warnt DHPG-Rechtsanwalt Feinendegen. Vor Ort gehen die Steuerfahnder systematisch vor. Fühlen sie sich bei ihren Ermittlungen gebremst, sehen sie darin eine Bestätigung, dass sie auf der richtigen Spur sind. Ablenkungsversuche nehmen Steuerfahnder gerne zum Anlass, gerade dort weiter zu suchen, wo man es gerade nicht haben will.
Zwar sollten Steuerzahler keine Unterlagen freiwillig herausgeben, doch sollten sie verschlossene Türen oder Tresore auf Nachfrage öffnen. Andernfalls werden die Beamten den Schlüsseldienst bestellen, was zusätzliche Kosten verursacht.
Ein eingeschränkt kooperatives Verhalten kann sich für die Steuerzahler durchaus auszahlen. „Wer Suchhilfe leistet, kann die Dauer der Durchsuchung meist deutlich verkürzen und unter Umständen Zufallsfunde vermeiden“, sagt Rechtsanwalt Feinendegen von der Kanzlei DHPG.
Steuerfahnder auf Prüfungstour
Die Finanzbehörden haben ein neues Merkblatt veröffentlicht, das die Prüfungsbefugnisse von Steuerfahndern ausweitet. Worauf sich Steuerpflichtige einstellen sollten:
1. Mitwirkung ist Pflicht: Steuerpflichtige müssen nunmehr nicht nur alle steuerlich relevanten Unterlagen zur Einsicht und Prüfung vorlegen, sondern auch Fragen dazu wahrheitsgemäß beantworten. Steuerfahnder dürfen digitale Daten jetzt auch mit den firmeneigenen IT-Systemen prüfen oder eine spezielle Auswertung fordern. Auf Verlangen müssen Steuerpflichtige digitale Daten auf einem Datenträger aushändigen.
2. Zwangsmittel erlaubt: Bei mangelnder Kooperation kann der Fiskus etwa ein Zwangsgeld festsetzen. Zudem können die Finanzbehörden nachteilige Schlüsse ziehen und eine Steuerschätzung vornehmen. Unzulässig sind Zwangsmittel, wenn bereits ein Straf- oder Bußgeldverfahren läuft und Steuerzahler sich durch ihre Mitwirkung selbst belasten würden.
3. Strafverfahren droht: Bei Hinweisen auf eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit wird unverzüglich ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Fahnder haben dann polizeiliche Befugnisse und dürfen zum Beispiel Beschlagnahmungen oder Durchsuchungen anordnen. Steuerzahler müssen vorab über ihre Rechte im Rahmen eines Strafverfahrens aufgeklärt werden.